Unser Leben sollte nicht geprägt von Angst sein. Doch diese so starke Emotion begegnet uns immer wieder in verschiedenen Formen – für manche Menschen ist sie gar steter Begleiter. Angst kann unser Denken rasch in die Irre führen, unser Verhalten verbiegen und unser Inneres in Aufruhr bringen.
Aber... ist Angst auch ein Faktor als Erwachsener im beruflichen Kontext? Was klar ist, egal ob wir die umfassenden Studien, unsere persönliche Erfahrung oder die Erkenntnisse großer Geister heranziehen – Angst hat einen massiven Einfluss auf uns und auf jeden Aspekt unserer Existenz und damit natürlich auch Arbeitsleistung und Führung.
„Angst verengt die Aufmerksamkeit – sie macht uns blind für das Ganze.“
Daniel Goleman
„Angst ist nicht nur lähmend – sie ist entstellend. Sie verzerrt unsere Wahrnehmung der Welt.“
Rollo May
Es ist nun leicht zu verstehen, dass wir garantiert keine Angst in Unternehmen gebrauchen können. Sie ist ein Killer für jede höhere Leistung, für jede höhere Form der Zusammenarbeit. Angst spaltet. Sie führt in die Verteidigung. Sie hält unsere Vorstellungskraft gefangen und formt ständig neue Bedrohungen – so wie wir Monster in der Nacht kreieren, obwohl wir eigentlich wissen: „Da ist gar nichts.“
Wenn in Unternehmen das Gefühl der Sicherheit, des Vertrauens verloren geht, weil wir nicht wissen, ob/wo der nächste Angriff herkommt – haben wir massive Probleme. Diese finden sich auf der menschlichen Ebene und sie verbinden sich zusätzlich zu einem unfassbaren Wettbewerbsvorteil, weil ein Großteil der Energie in den Aufbau von Verteidigung geht bzw. in den Angriff gegen interne Bedrohungen fließt.
„In angstbesetzten Organisationen wird nicht gelernt – es wird verteidigt.“
Peter Senge
„Wenn Angst regiert, wird Zusammenarbeit zur Kontrolle und Kommunikation zur Verteidigung.“
Margaret Wheatley
Durch was Angst in uns ausgelöst wird, in welcher Form wir sie empfinden (Druck, Überforderung, Demütigung, Bedrohung unserer Position, etc.) und wie wir mit ihr umgehen, verändert sich jedoch. Nicht weil die Welt sich ändert, sondern weil sich unser Inneres weiterentwickelt – im Idealfall. Je weiter wir uns entwickeln, umso weniger stört uns Angst und wir zunehmend ein Signal für Wachstum, ein wichtiger Hinweis auf eine Störung im System. Das, was früher Angst machte, wird dann neugierig und offen willkommen geheißen. Wie sich Angst über die Stufen unserer Entwicklung verändert und wie wir damit umgehen, soll Inhalt der nächsten Seiten sein.
„Die Höhle, in die du dich nicht traust zu gehen, birgt den Schatz, den du suchst.“
C.G. Jung
„Die Angst vor Kritik ist die Angst, sich selbst zu begegnen.“
Erich Fromm
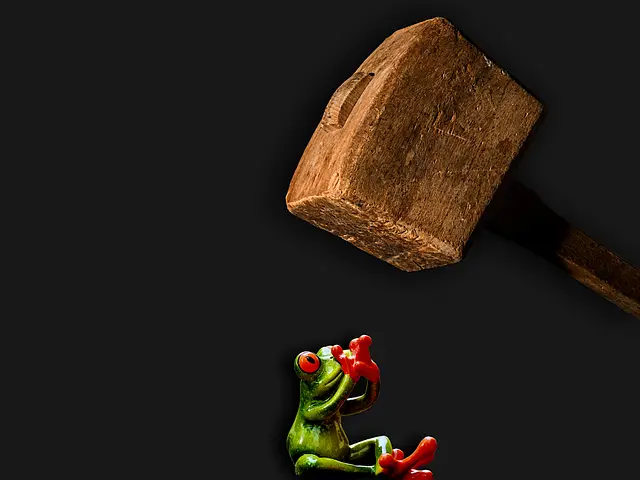
E4 – „To be part of“
„Die Angst, sich zu blamieren, ist die Angst vor dem Blick der anderen – und damit vor sich selbst.
Theodor W. Adorno
Grundstruktur dieser Stufe
- Fokus liegt auf Zugehörigkeit, Konformität, sozialer Akzeptanz
- Das Ich definiert sich über die Gruppe: „Ich bin, weil ich dazugehöre“
- Sicherheit entsteht durch Anpassung – nicht durch Selbstdefinition
Welche Ängste dominieren auf E4 => was lösen sie aus?
Angst vor Ausschluss
„Was, wenn ich nicht mehr dazugehöre?“ => Hohe Anpassungsbereitschaft, Selbstverleugnung
Angst vor Bewertung
„Was denken die anderen über mich?“= > Starke soziale Kontrolle, Unsicherheit bei Kritik
Angst vor Konflikt
„Was, wenn ich anecke?“ => Vermeidung von Konfrontation, Harmoniesucht
Diese Ängste sind nicht individuell reflektiert, sondern sozial vermittelt.
Sie entstehen aus dem Bedürfnis, Teil eines stabilen sozialen Gefüges zu sein.
Welche Ängste sind weniger relevant?
- Existenzielle Ängste (z. B. Sinnverlust, systemische Dysbalance) – noch nicht im Horizont
- Komplexitätsängste – die Welt wird eher binär erlebt: drinnen vs. draußen
- Selbstreflexive Ängste – kaum vorhanden, da das Ich noch nicht als innerer Beobachter etabliert ist
Wie wirkt Angst auf das Verhalten?
- Angst führt zu Anpassung statt Ausdruck
- Entscheidungen werden gruppenkompatibel getroffen
- Kritik wird als Bedrohung der Zugehörigkeit erlebt
- Konflikte werden vermeidet oder geschluckt, nicht bearbeitet
Wie kann Angst verstanden werden?
In dieser Stufe ist Angst kein Signal zur Selbstreflexion, sondern ein sozialer Alarm. Sie zeigt:
- Wo das Ich seine Zugehörigkeit gefährdet sieht
- Wo Gruppennormen dominieren
- Wo die eigene Position noch nicht autonom gedacht wird
Wie kann ich die Angst nutzen?
- Angst kann als Hinweis dienen, wo das Ich sich noch über andere definiert
- Sie zeigt, welche sozialen Muster das Verhalten steuern
- Sie kann helfen, erste Schritte zur Selbstverortung zu initiieren – z. B. durch Fragen wie: „Was wäre, wenn ich nicht dazugehöre – bin ich dann weniger ich?“
Entwicklungspotenzial
Der Übergang zu E5 beginnt dort, wo Angst nicht mehr nur sozial gedeutet wird, sondern als Ausdruck eines inneren Wertesystems. Die Frage verschiebt sich von:
„Was denken die anderen?“ zu „Was denke ich über mich – und wie will ich gesehen werden?“
Typische Reaktionen auf Angst in Organisationen (E4)
- Indirekte Klage statt direkter Ansprache
- „Ich weiß nicht, ob das so gut läuft…“
- „Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht…“
- Funktion: soziale Resonanz testen, ohne sich zu exponieren
- Ziel: Gleichgesinnte finden, bevor man sich positioniert
- Bündelbildung durch Jammern
- Kleine Unzufriedenheit wird geteilt → andere stimmen zu → Gruppe entsteht
- Die Gruppe bietet Schutz und soziale Legitimation
- Angst wird kollektiv abgefedert, nicht individuell bearbeitet
- Konformitätsdynamik
- Sobald eine Gruppe als „neue Norm“ erscheint, schließen sich weitere an
- Nicht aus Überzeugung, sondern aus Zugehörigkeitsbedürfnis
- Kritik wird nicht inhaltlich geprüft, sondern sozial übernommen
- Vermeidung von Konfrontation
- Direkte Ansprache wird vermieden – aus Angst, die Gruppe zu verlieren
- Selbst „direkte“ Menschen halten sich zurück, wenn die Gruppendynamik stark ist
- Kritik wird hinter vorgehaltener Hand geäußert, nicht im offenen Raum
Meta-Einschätzung
Das „kleine Jammern“, das „Sammeln von Gleichgesinnten“, das „Mitgehen mit der Gruppe“ – ist auf E4 kein Mangel an Mut, sondern Ausdruck einer noch nicht autonomen Ich-Struktur. Die Angst ist nicht individuell – sie ist sozial codiert. Und genau deshalb ist sie so wirksam in Organisationen:
- Sie erzeugt stille Dynamiken, die von Führung oft nicht gesehen werden kann
- Sie verhindert echte Klärung, weil Zugehörigkeit wichtiger ist als Wahrheit
- Sie kann nur durch Entwicklungsimpulse aufgelöst werden – nicht durch Appelle
Warum Schuldzuweisung auf E4 so attraktiv ist
- Schuld bietet Klarheit: In einem binären Weltbild (richtig/falsch, drinnen/draußen) ist Schuld eine einfache, schnelle Lösung
- Schuld schützt die Gruppe: Wer „schuld“ ist, kann ausgeschlossen werden – und die Gruppe bleibt intakt.
- Schuld entlastet das Ich: Wenn der andere schuld ist, muss ich mich nicht hinterfragen
- Schuld verhindert Resonanz: Denn Resonanz würde bedeuten, sich selbst als Teil des Systems zu sehen und damit hätte ich einen Anteil am Problem
Typische Eskalationslogik auf E4
- Unbehagen entsteht – z. B. durch eine Entscheidung, ein Verhalten, eine Veränderung, eine Kränkung, etc.
- Indirektes Jammern beginnt – man sucht Gleichgesinnte, ohne sich zu exponieren
- Bündelbildung – die Gruppe wächst, die Kritik wird schaukelt sich auf
- Schuldiger wird identifiziert – gemeinsames Feindbild wird geschärft
- Eskalation nach oben – Die Führung soll das Problem „lösen“ (eliminieren), ohne dass echter Dialog stattfindet
- Frontenbildung – die Organisation spaltet sich in Lager
- Systemische Klärung bleibt aus – weil niemand den Raum dafür öffnet
Wie kann eine solche Erklärung helfen so eine Situation aufzulösen?
- Spiegelung statt Belehrung: Menschen erkennen sich wieder – nicht weil sie kritisiert werden, sondern weil sie sich verstanden fühlen
- Innehalten statt Verteidigen: Die Darstellung lädt zur Reflexion ein, nicht zur Reaktion
- Entwicklung statt Eskalation: Wer erkennt, dass sein Verhalten aus Angst entsteht, kann beginnen, es zu transformieren
- Raum für Resonanz: Wenn Schuld nicht mehr das Ziel ist, kann Beziehung wieder entstehen

Stufe E5 – „To be rational / besonders“
„Die Angst vor Kritik ist die Angst, sich selbst zu begegnen.“
Erich Fromm
Grundstruktur dieser Stufe
- Fokus liegt auf Selbstdefinition, Abgrenzung, Leistung und Besonderheit
- Das Ich will sich unterscheiden, profilieren, kompetent erscheinen
- Sicherheit entsteht durch Kontrolle, Selbstbehauptung und Vergleich
Welche Ängste dominieren auf E5 => was lösen sie aus?
Angst vor Bedeutungslosigkeit
„Was, wenn ich nichts Besonderes bin?“ => Streben nach Abgrenzung, Selbstdarstellung
Angst vor Kontrollverlust
„Was, wenn ich die Situation nicht im Griff habe?“ => Mikromanagement, Widerstand gegen Unsicherheit
Angst vor Inkompetenz
„Was, wenn ich nicht gut genug bin?“ => Leistungsdruck, Perfektionismus, Abwertung anderer
Diese Ängste sind individuell gefärbt, aber noch nicht tief reflektiert. Sie entstehen aus dem Bedürfnis, sich als wertvoller, kompetenter, leistungsfähiger und einzigartiger Mensch zu erleben. Deshalb wird auch jede Form von Kritik gefürchtet und löst reflexmäßig starkes Abwehrverhalten ein. Da das Selbstbild stark an Leistung und Vergleich gekoppelt ist, wird Kritik nicht als Entwicklungschance, sondern als potenzielle Bedrohung der eigenen Identität erlebt. In Organisationen zeigt sich das häufig in perfektionistischen Tendenzen, überhöhtem Anspruchsdenken oder subtiler Konkurrenzhaltung – oft begleitet von einem hohen Bedürfnis nach Anerkennung und Sichtbarkeit.
Welche Ängste sind weniger relevant?
- Soziale Ausschlussängste – Zugehörigkeit ist weniger wichtig als Profilierung
- Existenzielle Sinnfragen – noch nicht im Fokus, da das Ich stark mit Leistung identifiziert ist und Werte/Sinn mehr sekundär an der Oberfläche trage.
- Systemische Komplexitätsängste – werden oft verdrängt oder durch Kontrolle kompensiert
Wie wirkt Angst auf das Verhalten (Stufe E5)?
- Angst führt zu Selbstoptimierung und Vergleichsdenken
- Entscheidungen werden strategisch und kontrolliert getroffen
- Kritik wird als Angriff auf die Kompetenz erlebt, nicht als Entwicklungsimpuls
- Konflikte werden rationalisiert oder abgewehrt, nicht emotional durchlebt
- Kritik löst oft spontane Rechtfertigung aus – das Ich versucht, sich zu erklären, bevor es reflektiert
- Es entsteht die Tendenz, das Standing der Kritiker zu relativieren oder zu untergraben – z. B. durch subtile Abwertung oder Infragestellung ihrer Kompetenz
- Rückmeldungen werden selektiv angenommen, wenn sie ins Selbstbild passen – sonst als „nicht relevant“ abgetan
- Das Ich zeigt eine hohe Sensibilität für Status und Wirkung – oft verbunden mit dem Bedürfnis, „gut dazustehen“
- Emotionale Verletzungen werden nicht in sich aufgearbeitet, sondern intellektuell umgedeutet, um die eigene Souveränität zu wahren
Wie kann Angst verstanden werden?
In dieser Stufe ist Angst ein innerer Leistungsindikator – sie zeigt, wo das Ich sich nicht kompetent oder besonders genug fühlt. Sie zeigt:
- Wo das Ich sich über Leistung und Kontrolle definiert
- Wo Unsicherheit als Schwäche erlebt wird
- Wo Selbstwert an äußere Anerkennung gekoppelt ist
Wie kann ich die Angst nutzen?
- Angst kann als Hinweis dienen, wo das Ich sich zu stark über Vergleich und Kontrolle stabilisiert
- Sie zeigt, welche inneren Narrative das Verhalten steuern („Ich muss besser sein“)
- Sie kann helfen, erste Schritte zur Selbstakzeptanz und innerer Kohärenz zu initiieren – z. B. durch Fragen wie: „Was macht mich aus, wenn ich nicht besser bin als andere?“ „Was passiert, wenn ich Unsicherheit zulasse?“
Entwicklungspotenzial
Der Übergang zu E6 beginnt dort, wo Angst nicht mehr nur als Bedrohung der Kompetenz erlebt wird, sondern als Spiegel innerer Werte und moralischer Kohärenz. Die Frage verschiebt sich von:
„Wie gut bin ich & was denken die anderen von mir?“ zu
„Was ist mir wirklich wichtig – und wie lebe ich das?“
Typische Reaktionen auf Angst in Organisationen (E5)
- Kritik als Kompetenzschutz
- „Ich sehe da massive Schwächen im Vorgehen…“
- „Das ist fachlich nicht sauber gelöst.“
- Funktion: Distanzierung vom Problem, um eigene Position zu sichern
- Ziel: Selbstwert durch Abwertung anderer stabilisieren
- Bündelung durch Meinung und Status
- Gleichgesinnte werden nicht über Zugehörigkeit gesucht, sondern über gemeinsame Kritikfähigkeit
- Gruppen entstehen durch geteilte Meinungen, nicht durch emotionale Nähe
- Angst wird durch intellektuelle Allianz abgefedert: „Wir sind die, die es richtig sehen“
- Kompetenzdynamik
- Wer sich als besonders kompetent zeigt oder einen höheren Rang bekleidet, wird zum Meinungsführer
- Andere schließen sich an – nicht aus Gruppendruck, sondern aus Statusorientierung
- Kritik wird inhaltlich übernommen, aber oft ohne eigene Reflexion
- Vermeidung von Schwäche
- Direkte Ansprache wird vermieden, wenn sie Unsicherheit oder Unwissen offenlegen könnte
- Selbst „offene“ Menschen halten sich zurück, wenn sie befürchten, ihre Kompetenz zu verlieren
- Kritik wird strategisch platziert, nicht aus Beziehungspflege, sondern zur Positionierung
Meta-Einschätzung
Das intellektuelle Bündeln, die strategische Kritik, die Selbstpositionierung durch Abwertung – ist auf E5 kein Mangel an Empathie, sondern Ausdruck einer Ich-Struktur, die sich über Kompetenz und Besonderheit stabilisiert. Die Angst ist nicht sozial codiert, sondern statusbezogen. Und genau deshalb ist sie so wirksam in Organisationen:
- Sie erzeugt Leistungsdruck, der als Rationalität getarnt ist
- Sie verhindert echte Verletzlichkeit, weil Schwäche als Gefahr gilt
- Sie kann nur durch Entwicklung zur Werteorientierung (E6) aufgelöst werden – nicht durch Appelle zur Offenheit
Warum Schuldzuweisung auf E5 so attraktiv ist
- Schuld bietet Selbstschutz: In einem leistungsorientierten Weltbild ist Schuld eine Möglichkeit, die eigene Kompetenz unangetastet zu lassen
- Schuld stabilisiert Status: Wer „schuld“ ist, war offensichtlich nicht kompetent – das schützt die eigene Position.
- Schuld entlastet das Ich: Wenn der andere versagt hat, muss ich meine eigene Unsicherheit nicht zeigen
- Schuld verhindert Selbstreflexion: Denn das würde bedeuten, die eigene Leistung oder Logik infrage zu stellen
Typische Eskalationslogik auf E5
- Unbehagen entsteht – z. B. durch Unsicherheit, Kritik, Kontrollverlust, widersprüchliche Informationen
- Kritik wird rationalisiert – man äußert Zweifel an der fachlichen Qualität oder Logik in der Situation bzw. der Kritik
- Meinungsbündelung beginnt – Gleichgesinnte werden gesucht, die dieselbe Analyse teilen bzw. in die eigene Sichtweise hineingezogen werden können
- Schuldiger wird identifiziert – meist die Person, die „unprofessionell“ oder „unsystematisch“ agiert und damit das eigene Ansehen beschädigt.
- Eskalation nach oben – Führung soll entscheiden, wer „recht“ hat – nicht moderieren, sondern bewerten, entscheiden und durchsetzen
- Frontenbildung – es entstehen Lager: die „Kompetenten“ vs. die „Fehlgeleiteten“
- Systemische Klärung bleibt aus – weil niemand die Unsicherheit oder Mehrdeutigkeit zulassen will
Wie kann eine solche Erklärung helfen so eine Situation aufzulösen?
- Spiegelung statt Belehrung: Menschen erkennen, dass ihre Kritik oft aus Selbstschutz entsteht – nicht aus objektiver Analyse
- Innehalten statt Positionieren: Die Darstellung lädt dazu ein, die eigene Angst vor Kontrollverlust zu reflektieren
- Entwicklung statt Eskalation: Wer erkennt, dass Schuldzuweisung ein Abwehrmechanismus ist, kann beginnen, Unsicherheit zuzulassen
- Raum für Resonanz: Wenn Kompetenz nicht mehr verteidigt werden muss, kann echter Dialog entstehen
Möglicher Impuls für Organisationen
„Wenn du jemanden kritisierst – frag dich nicht zuerst, ob er falsch liegt. Frag dich, ob du gerade Angst hast, nicht kompetent genug zu wirken.“

Stufe E6 – „To be effective“
„Mögen deine Entscheidungen deine Hoffnungen und nicht deine Ängste widerspiegeln.“
Nelson Mandela
Grundstruktur dieser Stufe
- Fokus liegt auf Werteorientierung, moralischer Klarheit, Wirksamkeit im Handeln
- Das Ich will integer, verantwortlich und sinnvoll agieren
- Sicherheit entsteht durch Kohärenz zwischen Innen und Außen – nicht mehr durch Status oder Kontrolle
Welche Ängste dominieren auf E6 => was lösen sie aus?
Angst vor moralischem Scheitern
„Was, wenn ich gegen meine Werte handle?“ => Selbstkritik, Schuldgefühle, Rückzug
Angst vor Unwirksamkeit
„Was, wenn mein Handeln nichts bewirkt?“ => Frustration, Aktivismus, Überengagement
Angst vor innerer Inkohärenz
„Was, wenn ich nicht stimmig bin?“ => Selbstzweifel, Grübeln, Identitätsfragen
Diese Ängste sind reflektiert und wertebasiert. Sie entstehen aus dem Bedürfnis, authentisch und verantwortungsvoll zu handeln – nicht nur kompetent oder besonders. Das starke Bedürfnis Verantwortung für andere/Schwächere zu übernehmen schlägt um in die Angst, Verantwortung nicht wahrzunehmen – sich nicht in den Spiegel schauen zu können.
Welche Ängste sind weniger relevant?
- Vergleichsängste – das Ich misst sich weniger an anderen
- Statusverlust – nicht mehr zentral, da das Selbstbild aus innerer Kohärenz entsteht
- Soziale Anpassungsängste – Zugehörigkeit ist wichtig, aber nicht um jeden Preis
Wie wirkt Angst auf das Verhalten?
- Angst führt zu Selbstreflexion und Werteprüfung
- Entscheidungen werden ethisch und langfristig gedacht
- Kritik wird als moralischer Impuls erlebt – nicht als Angriff
- Konflikte werden ernst genommen, aber oft mit hohem emotionalem Aufwand bearbeitet
- Das Ich übernimmt Verantwortung auch für andere, aus dem Wunsch heraus, „das Richtige“ zu tun – was zu Überverantwortung führen kann
- Es entsteht eine Tendenz zur Selbstkritik, wenn das eigene Verhalten nicht mit den inneren Werten übereinstimmt – oft verbunden mit Schuldgefühlen
- In der Angst, nicht integer zu handeln, kann das Ich in moralische Überhöhung oder Rigidität kippen – z. B. durch Unnachgiebigkeit gegenüber „unethischem“ Verhalten anderer
Wie kann Angst verstanden werden?
In dieser Stufe ist Angst ein moralischer Kompass – sie zeigt, wo das Ich sich nicht stimmig, nicht wirksam oder nicht integer erlebt. Sie zeigt:
- Wo das eigene Handeln nicht mit den inneren Werten übereinstimmt
- Wo Verantwortung übernommen wird, aber Wirkung fehlt
- Wo das Ich beginnt, sich als Teil eines größeren Zusammenhangs zu sehen
Wie kann ich die Angst nutzen?
- Angst kann als Hinweis dienen, wo das Ich sich selbst zu hohe moralische Ansprüche stellt
- Sie zeigt, welche Werte das Verhalten prägen – und wo sie in Spannung geraten
- Sie kann helfen, erste Schritte zur Ambiguitätstoleranz und systemischer Perspektive zu initiieren – z. B. durch Fragen wie: „Was ist mein Anteil – und was liegt außerhalb meiner Verantwortung?“ „Wie kann ich wirksam sein, ohne perfekt zu sein?“
Entwicklungspotenzial
Der Übergang zu E7 beginnt dort, wo Angst nicht mehr nur als moralischer Prüfstein erlebt wird, sondern als Signal für systemische Komplexität und Kontextabhängigkeit. Die Frage verschiebt sich von:
„Bin ich integer?“ zu „Wie wirkt mein Handeln im größeren Zusammenhang – und wie kann ich mit Mehrdeutigkeit leben?“
Hier zeigt sich ein ganz zentraler Entwicklungssprung, der in der Ich-Entwicklung oft unterschätzt wird: Die Verschiebung der Angstquelle von außen nach innen.
In E6 – „To be effective“ beginnt das Ich, sich nicht mehr über äußere Marker wie Status, Zugehörigkeit oder Kompetenz zu definieren, sondern über innere Werte, moralische Kohärenz und Wirksamkeit. Und das verändert die gesamte Architektur der Angst.
Was sich in E6 grundlegend verändert
- Kritik von außen verliert ihre Bedrohlichkeit → Sie wird nicht mehr als Angriff auf das Selbst erlebt, sondern als potenzieller Impuls zur Reflexion
- Angst entsteht nicht durch andere, sondern durch das Gefühl, den eigenen Werten nicht gerecht zu werden → Das Ich wird zum inneren Maßstab – nicht mehr die Gruppe, der Status oder die Leistung
Was das im beruflichen Kontext bedeutet
- Du kannst in einem Meeting kritisiert werden – und spürst keine Angst, sondern prüfst: „Ist da etwas dran?“ „Was ist der Hintergrund seiner Einschätzung – sehe ich etwas nicht, was er sieht, oder sieht er etwas nicht, was ich sehe?“
- Du siehst, dass jemand dich ablehnt – und denkst: „Das ist sein Kontext, nicht mein Selbst.“
- Du wirst mit Unsicherheit konfrontiert – und fragst dich: „Wie kann ich trotzdem wirksam und integer handeln?“
Das bedeutet nicht, dass die Emotion nicht mehr hast – aber Angst verliert ihre lähmende Funktion und Intensität. Sie wird zur moralischen Rückkopplung, nicht zur sozialen Bedrohung. Wenn Angst entsteht, ist sie eine sanfte Signalwirkung, der man Beachtung schenken kann, um mehr Klarheit über die Situation und oder sich zu erlangen.
Typische Reaktionen auf Angst in Organisationen (E6)
- Selbstkritik statt Schuldprojektion
- „Ich frage mich, ob ich hier richtig gehandelt habe…“
- „Ich bin mir nicht sicher, ob das mit meinen Werten vereinbar ist.“
- Funktion: innere Prüfung, nicht soziale Absicherung
- Ziel: Stimmigkeit herstellen, nicht Recht behalten
- Bündelung durch Werte und Haltung
- Gleichgesinnte werden gesucht, die ähnliche ethische Maßstäbe vertreten
- Gruppen entstehen durch gemeinsame moralische Orientierung, nicht durch Status oder Konformität
- Angst wird durch geteilte Verantwortung abgefedert: „Wir wollen das Richtige tun“
- Integritätsdynamik
- Wer als integer und verantwortungsvoll gilt, wird zum Orientierungspunkt
- Andere schließen sich an – nicht aus Anpassung, sondern aus Resonanz mit Haltung
- Kritik wird wertbasiert geteilt, nicht strategisch platziert
- Vermeidung von moralischer Inkohärenz
- Direkte Ansprache wird gesucht, wenn sie zur Klärung beiträgt – aber vermieden, wenn sie als verletzend oder unethisch erlebt wird
- Selbst „reflektierte“ Menschen zögern, wenn sie befürchten, anderen nicht gerecht zu werden
- Kritik wird vorsichtig formuliert, oft mit hohem emotionalem Aufwand
Meta-Einschätzung
Das vorsichtige Formulieren, die Suche nach ethischer Stimmigkeit, die gemeinsame Verantwortung – ist kein Zeichen von Unsicherheit, sondern Ausdruck einer Ich-Struktur, die sich über Werte und Wirkung definiert. Die Angst ist nicht sozial oder statusbezogen, sondern moralisch codiert. Und genau deshalb ist sie so wirksam in Organisationen:
- Sie erzeugt hohe emotionale Tiefe, aber auch Verletzlichkeit
- Sie verhindert oberflächliche Klärung, weil das Ich nach Sinn und Integrität sucht
- Sie kann nur durch Ambiguitätstoleranz und systemisches Denken weiterentwickelt werden – nicht durch Appelle zur Effizienz
Warum Schuldzuweisung dennoch vorkommt – aber anders
- Schuld wird nicht impulsiv zugewiesen, sondern oft reflektiert und moralisch begründet
- Das Ich will Verantwortung übernehmen – und kann dabei zu viel auf sich nehmen oder zu viel auf andere projizieren, wenn die Werte verletzt erscheinen
- Schuldzuweisung entsteht nicht aus Kränkung, sondern aus dem Gefühl: „Das ist nicht richtig – und jemand muss dafür einstehen“
Typische Eskalationslogik auf E6
- Unbehagen entsteht – z. B. durch ethische Dissonanz, mangelnde Wirkung, moralische Inkohärenz
- Selbstreflexion beginnt – das Ich prüft: „Bin ich Teil des Problems?“
- Empörung wird geteilt – nicht laut, sondern differenziert: „Das widerspricht unseren Werten“
- Verantwortung wird übernommen – oft auch für andere: „Ich spreche für jene, die sich nicht äußern können“
- Schuldiger wird identifiziert – nicht als Person, sondern als Verursacher einer moralischen Inkohärenz
- Eskalation erfolgt über Haltung – nicht über Lautstärke, sondern über ethische Dringlichkeit
- Systemische Klärung wird gesucht, aber oft emotional überfrachtet, weil das Ich sich tief involviert fühlt
Wie kann eine solche Erklärung helfen so eine Situation aufzulösen?
- Spiegelung statt Bewertung: Menschen erkennen, dass ihre moralische Empörung auch ein Schutzmechanismus sein kann
- Innehalten statt Übernahme: Die Darstellung lädt dazu ein, Verantwortung zu differenzieren – nicht zu verallgemeinern
- Entwicklung statt Eskalation: Wer erkennt, dass Schuldzuweisung auch aus Überverantwortung entstehen kann, kann beginnen, Grenzen zu setzen
- Raum für Resonanz: Wenn Schuld nicht mehr moralisch aufgeladen wird, sondern als systemisches Muster erkannt wird, entsteht echte Klärung
Warum sich Eskalationen in E6-dominierten Organisationen seltener aufschaukeln
- Individuelle Selbstreflexion: Menschen auf E6 prüfen zuerst sich selbst, bevor sie andere bewerten
- Wertebasierte Kommunikation: Kritik wird vorsichtig, respektvoll und oft dialogisch eingebracht
- Ambiguitätstoleranz: Unterschiedliche Perspektiven werden nicht sofort als Bedrohung erlebt
- Verantwortungsbewusstsein: Das Ich übernimmt Verantwortung für Wirkung – nicht nur für Absicht
Das führt zu einer deeskalierenden Grundhaltung, die Eskalationsspiralen früh abfängt oder gar nicht entstehen lässt.
Aber: Die Schattenseite – Resonanz als Einfallstor für Instrumentalisierung
Gerade weil E6-Menschen:
- empathisch sind
- sich für andere einsetzen
- moralisch sensibel reagieren
- Konflikte nicht scheuen, aber differenziert führen wollen
…können sie in Organisationen leicht zu Verbündeten gemacht werden, wenn andere (z. B. auf E4 oder E5) ihre eigenen Konflikte nicht direkt austragen, sondern über Bündelung und moralische Aufladung Macht generieren wollen.
Typisches Muster der Instrumentalisierung
- Ein E4/E5-Mensch fühlt sich verletzt oder bedroht, spricht es aber nicht direkt an
- Stattdessen beginnt er, emotional oder strategisch Gleichgesinnte zu sammeln
- Ein E6-Mensch wird angesprochen – nicht mit Fakten, sondern mit moralischer Empörung oder Leidensdruck
- Der E6-Mensch geht in Resonanz, fühlt sich verantwortlich, will helfen
- Die Gruppe wächst – und plötzlich entsteht eine moralisch aufgeladene Eskalation, die nicht aus E6 stammt, aber durch E6 legitimiert wird
Damit ergibt sich nicht nur ein psychologisches Muster, sondern eine organisationskulturelle Dynamik, die oft unter der Oberfläche wirkt und dennoch ganze Teams, Projekte oder Führungssysteme destabilisieren kann.

Die Resonanz-Eskalation
bezeichnet die Dynamik, in der unverarbeitete Kränkungen auf niedrigeren Ich-Stufen durch die Resonanzfähigkeit reiferer Menschen legitimiert und eskaliert werden – ohne dass die ursprüngliche Spannung selbstverantwortlich bearbeitet wurde.
- Die Kränkung als Ursprung
- Auf E4/E5 wird Kritik & Spannung nicht als innerer Prozess erkannt, sondern als äußere Bedrohung, als Kontrollverlust, Kränkung, Bedrohung
- Die Kränkung wird nicht reflektiert oder selbstverantwortlich bearbeitet, sondern externalisiert: „Der andere hat mich verletzt“
- Es entsteht ein Bedürfnis nach Vergeltung oder Wiederherstellung von Ordnung/Status
- Um nicht allein zu stehen, wird Bündelung mit anderen gesucht – oft durch emotionale oder moralische Aufladung
- Die Instrumentalisierung reiferer Menschen als Verstärker
- Reifere Menschen (v. a. E6) werden angesprochen – nicht mit Fakten, sondern mit emotionaler oder moralischer Empörung
- Ihre Resonanzfähigkeit wird genutzt, um Betroffenheit für den Auslöser und Legitimität für das Vorgehen zu erzeugen
- Sie übernehmen Verantwortung, obwohl sie nicht die Quelle des Konflikts sind
- Die Eskalation wird dadurch ethisch aufgeladen, obwohl sie aus unverarbeiteten Mustern stammt
- Die Systemblindheit als Folge
- Die Organisation sieht nur die Oberfläche: „Da ist ein Konflikt, da ist Empörung“
- Die eigentliche Dynamik – Kränkung → Bündelung → Instrumentalisierung – bleibt unsichtbar
- Führung reagiert auf Druck, nicht auf Tiefe
- Die Eskalation wird bearbeitet, aber nicht gelöst
Warum das gefährlich ist
- Die ursprüngliche Kränkung bleibt unbearbeitet, weil sie nicht in Selbstverantwortung gebracht wird
- Die Eskalation wirkt legitim, weil sie von „reflektierten“ Menschen getragen wird
- Die Organisation erlebt Spaltung, obwohl die reiferen Beteiligten eigentlich Verbindung suchen wollen würden
- Die Führung wird unter Druck gesetzt, ohne dass echte Klärung möglich ist
- Das System lernt: Empörung + Resonanz = Macht – und reproduziert das Muster
Dies ist ein Muster, das in fast jeder Organisation wirkt – und das oft als „menschlich“ oder „politisch“ abgetan wird, obwohl es strukturell und entwicklungspsychologisch erklärbar ist.
Und genau das ist der Schlüssel:
- Wenn Menschen erkennen, dass ihre Empörung nicht immer aus Reife, sondern manchmal aus Kränkung stammt
- Wenn reife Menschen lernen, ihre Resonanz zu differenzieren: „Spüre ich gerade echte Ungerechtigkeit – oder werde ich benutzt?“
- Wenn Organisationen Räume schaffen, in denen Spannung nicht eskaliert, sondern transformiert wird
Was E6-Menschen lernen können, um das zu vermeiden
- Resonanz ≠ Verantwortung: Nur weil ich etwas spüre, muss ich es nicht übernehmen
- Moralische Klarheit braucht Kontext: Nicht jede Verletzung ist Ausdruck von Unrecht
- Systemisches Denken schützt vor Vereinnahmung: Wer den Kontext sieht, erkennt auch die Dynamik hinter der Empörung
- Grenzen setzen ist Teil von Integrität: Nicht jede Bitte um Unterstützung ist ethisch geboten
Möglicher Impuls für E6-Führungskräfte
„Wenn du dich für jemanden einsetzen willst – frag dich zuerst, ob du gerade für seine Werte sprichst oder für seine Angst.“

Stufe E7 – „To be flexible“
„Frage dich jedes Mal, wenn du versucht bist, auf dieselbe Weise zu reagieren, ob du ein Gefangener der Vergangenheit oder ein Pionier der Zukunft sein möchtest.“
Deepak Chopra
Grundstruktur dieser Stufe
- Fokus liegt auf Kontextualisierung, Perspektivenvielfalt, systemischer Wirkung
- Das Ich erkennt sich als Teil eines dynamischen, komplexen Systems
- Sicherheit entsteht durch Flexibilität, Meta-Reflexion und situative Passung
- Identität wird fluid – nicht mehr über Werte, sondern über Verständnis und Wirkung
Welche Ängste dominieren auf E7 => was lösen sie in uns aus?
Angst vor systemischer Blindheit
„Was, wenn ich den Kontext falsch lese?“ => Überreflexion, Zögern, Rückzug
Angst vor Unwirksamkeit im Komplexen
„Was, wenn mein Handeln keine Wirkung entfaltet?“ => Aktionismus, Strategiewechsel, Selbstzweifel
Angst vor Beliebigkeit
„Was, wenn ich mich zu sehr anpasse und mich verliere?“ => Identitätsdiffusion, innere Unruhe, Sinnsuche
Diese Ängste sind hochreflektiert, aber oft ambivalent. Sie entstehen aus dem Bedürfnis, wirksam und stimmig im Kontext zu agieren, ohne sich selbst zu verlieren.
Welche Ängste sind weniger relevant?
- Soziale Ausschlussängste – Zugehörigkeit wird als situativ und fluide erlebt
- Status- und Kompetenzängste – das Ich misst sich nicht mehr an festen Kriterien
- Moralische Schuldgefühle – Werte sind relativiert, Verantwortung wird geteilt
Wie wirkt Angst auf das Verhalten?
- Angst führt zu Meta-Reflexion und Kontextprüfung
- Entscheidungen werden situativ und dynamisch getroffen – oft mit hohem Abwägungsaufwand
- Kritik wird als Perspektive verstanden – nicht als Angriff
- Konflikte werden systemisch betrachtet, aber manchmal nicht mehr emotional durchlebt
Wie kann Angst verstanden werden?
In dieser Stufe ist Angst ein Signal für systemische Komplexität – sie zeigt, wo das Ich sich nicht sicher ist, ob es den Kontext richtig versteht oder wirksam agiert. Sie zeigt:
- Wo das Ich zwischen Anpassung und Selbsttreue schwankt
- Wo Wirkung nicht linear ist und Unsicherheit zur Grundbedingung wird
- Wo das Bedürfnis nach Klarheit auf die Realität von Mehrdeutigkeit trifft
Wie kann ich die Angst nutzen?
- Angst kann als Hinweis dienen, wo das Ich zu viel Verantwortung übernimmt oder sich zu sehr relativiert
- Sie zeigt, welche systemischen Spannungen das Verhalten prägen
- Sie kann helfen, erste Schritte zur Resonanzfähigkeit und Sinnorientierung (E8) zu initiieren – z. B. durch Fragen wie: „Was ist mein Beitrag – auch wenn ich nicht alles verstehe?“ „Wie kann ich wirksam sein, ohne Kontrolle über das Ganze zu haben?“
Typische Reaktionen auf Angst in Organisationen (E7)
- Meta-Reflexion statt direkte Reaktion
- „Ich frage mich, ob wir hier gerade ein Muster reproduzieren…“
- „Könnte es sein, dass wir die falsche Ebene adressieren?“
- Funktion: Verlangsamung, um Komplexität zu erfassen
- Risiko: Zögern, Überreflexion, fehlende Entscheidungskraft
- Temporäre Allianzen statt feste Bündel
- Menschen auf E7 schließen sich situativ zusammen, wenn ein Thema systemisch relevant erscheint
- Es entstehen keine festen Gruppen, sondern Kontextkoalitionen
- Angst wird durch gemeinsames Denken abgefedert – nicht durch emotionale Nähe
- Systemische Mustererkennung statt Schuldzuweisung
- Probleme werden als Ausdruck von Strukturen gesehen, nicht als individuelles Versagen
- Kritik wird depersonalisiert: „Das ist ein systemischer Effekt, kein persönlicher Fehler“
- Risiko: Verantwortung kann sich auflösen, wenn alles relativiert wird
- Vermeidung von Vereinfachung
- Direkte Ansprache wird vermieden, wenn sie als zu binär oder zu emotional erscheint
- Selbst „klare“ Menschen zögern, wenn sie befürchten, Komplexität zu reduzieren
- Kritik wird kontextualisiert, aber manchmal nicht mehr greifbar gemacht
Meta-Einschätzung
Das vorsichtige Formulieren, die systemische Perspektive, die temporäre Kooperation – ist Ausdruck einer Ich-Struktur, die sich nicht mehr über Identität oder Werte stabilisiert, sondern über Kontextsensibilität und Wirkung. Die Angst ist nicht mehr sozial oder moralisch, sondern epistemisch:
„Verstehe ich genug, um wirksam zu sein?“
Und genau deshalb ist sie so wirksam in Organisationen:
- Sie erzeugt Verlangsamung, die oft als Unsicherheit missverstanden wird
- Sie verhindert vorschnelle Eskalation, aber auch klare Positionierung
- Sie kann nur durch den Übergang zu E8 aufgelöst werden – wo Vertrauen in Resonanz die Reflexion ablöst
Warum Schuldzuweisung auf E7 kaum noch attraktiv ist
- Schuld ist kein individuelles Versagen, sondern Ausdruck eines systemischen Musters
- Schuld bietet keine Klarheit mehr, sondern wirkt vereinfachend und reduzierend
- Schuld entlastet nicht, sondern erzeugt neue Komplexität: „Was hat das System dazu beigetragen?“
- Schuld verhindert systemische Resonanz, weil sie den Blick auf das Ganze verstellt
Das Ich auf E7 sucht Verstehen statt Verurteilen, Kontext statt Kausalität, Wirkung statt Schuld
Typische Eskalationslogik auf E7
- Unbehagen entsteht – z. B. durch widersprüchliche Wirkungen, systemische Dysbalancen
- Meta-Reflexion beginnt – das Ich fragt: „Was wirkt hier gerade – und warum?“
- Temporäre Allianzen entstehen – nicht zur Schuldzuweisung, sondern zur Mustererkennung und Weiterentwicklung
- Verantwortung wird verteilt – nicht ausweichend, sondern kontextsensibel
- Schuldiger wird nicht gesucht, sondern systemische Ursachen werden analysiert
- Eskalation wird vermieden, weil sie als Vereinfachung erkannt wird
- Systemische Klärung wird angestrebt, oft durch strukturverändernde Impulse
Wie kann eine solche Erklärung helfen so eine Situation aufzulösen?
- Spiegelung statt Polarisierung: Menschen erkennen, dass ihre Suche nach Schuld oft ein Bedürfnis nach Ordnung ist
- Innehalten statt Vereinfachen: Die Darstellung lädt dazu ein, Komplexität zuzulassen
- Entwicklung statt Eskalation: Wer erkennt, dass Schuldzuweisung das System nicht verändert, kann beginnen, Muster zu bearbeiten
- Raum für Resonanz: Wenn Schuld nicht mehr das Ziel ist, kann systemische Verantwortung entstehen
Möglicher Impuls für Organisationen
„Wenn du nach einem Schuldigen suchst – frag dich zuerst, ob du gerade versuchst, Komplexität zu reduzieren.“

Stufe E8 – „To be resonant / sinnorientiert“
„Die Aufgabe des Erwachsenen ist nicht, Angst zu vermeiden, sondern ihr einen Sinn zu geben.“
James Hollis
Grundstruktur dieser Stufe
- Fokus liegt auf Sinn, Resonanz, Lebendigkeit und Verbundenheit mit dem Ganzen
- Das Ich erkennt sich als Durchlass für Wirkung, nicht als Zentrum von Kontrolle
- Sicherheit entsteht durch Vertrauen in das, was entstehen will – nicht durch Planung oder Bewertung
- Identität wird transpersonal – das Ich ist nicht mehr das Subjekt, sondern Teil eines größeren Wirkens
Welche Ängste dominieren auf E8 => was lösen sie in uns aus?
Angst vor Entfremdung vom Sinn
„Was, wenn ich nicht mehr in Resonanz bin?“ => Rückzug, Innehalten, Neuorientierung
Angst vor innerer Leere
„Was, wenn nichts mehr durch mich wirken will?“ => Stille, Suche, Hingabe
Angst vor Überidentifikation mit dem Ich
„Was, wenn ich wieder in alte Muster falle?“ => Demut, Selbstbeobachtung, Loslassen
Diese Ängste sind nicht bedrohlich, sondern transformativ. Sie entstehen aus dem Bedürfnis, verbunden, durchlässig und sinnhaft zu wirken – nicht aus Mangel, sondern aus Tiefe.
Welche Ängste sind weniger relevant?
- Soziale, moralische oder statusbezogene Ängste – sie sind transzendiert
- Komplexitätsängste – Komplexität wird als natürlicher Ausdruck des Lebens verstanden
- Verantwortungsängste – Verantwortung wird geteilt, fließend, nicht als Last erlebt
Wie wirkt Angst auf das Verhalten?
- Angst wird als Resonanzstörung erlebt – nicht als Bedrohung
- Entscheidungen entstehen aus Stimmigkeit, nicht aus Strategie
- Kritik wird als Spiegel verstanden – nicht als Angriff
- Konflikte werden als Entwicklungsimpulse erkannt – nicht als Störung
Wie kann Angst verstanden werden?
In dieser Stufe ist Angst ein feines Resonanzsignal – sie zeigt, wo das Ich sich nicht mehr im Fluss, nicht mehr verbunden oder nicht mehr sinnhaft erlebt. Sie zeigt:
- Wo das Feld sich verändert – und das Ich neu lauschen muss
- Wo alte Muster sich zeigen – und liebevoll verabschiedet werden dürfen
- Wo Wirkung nicht mehr linear, sondern qualitativ entsteht
Wie kann ich die Angst nutzen?
- Angst kann als Hinweis dienen, wo das Ich sich zu sehr verfestigt, zu sehr „will“ statt „wirkt“
- Sie zeigt, welche Räume neu geöffnet werden wollen
- Sie kann helfen, erste Schritte zur radikalen Präsenz und Hingabe zu initiieren – z. B. durch Fragen wie: „Was will durch mich entstehen – wenn ich nichts kontrolliere?“ „Wo bin ich gerade nicht in Resonanz – und was braucht es, um wieder zu lauschen?“
Entwicklungspotenzial
Der Übergang zu E9 (falls man ihn überhaupt benennen will) beginnt dort, wo das Ich nicht mehr fragt, wie es wirken kann – sondern wo es sich ganz dem Leben überlässt. Die Frage verschiebt sich von:
„Was will ich tun?“ zu „Was will durch mich geschehen?“
Denn auf E8 ist Schuld kein relevantes Konzept mehr – nicht, weil alles erlaubt wäre, sondern weil das Ich erkannt hat, dass Wirkung, Verantwortung und Resonanz jenseits von Schuld operieren.
Wie wird das gesehen, wo früher Schuld oder Probleme gesehen wurden?
- Verantwortung wird geteilt
- „Was ist mein Anteil – und was will das System durch mich lernen?“
- Keine Schuldzuweisung, sondern Einladung zur Mitgestaltung
- Wirkung wird gespürt, nicht bewertet
- „Was hat mein Handeln ausgelöst – und was will sich dadurch zeigen?“
- Keine moralische Bewertung, sondern Resonanzprüfung
- Fehler werden als Impulse verstanden
- „Was will sich durch diesen Bruch neu ordnen?“
- Keine Sanktion, sondern Transformation
- Konflikte werden als Felder der Entwicklung erkannt
- „Was will hier sichtbar werden – und wie kann ich dem Raum geben?“
- Keine Eskalation, sondern Verlangsamung und Tiefe
Was diese Haltung bewirkt
- Entpolarisierung: Schuld trennt – Resonanz verbindet
- Entlastung: Das Ich muss nicht perfekt sein, sondern durchlässig
- Entwicklung: Fehler sind nicht zu vermeiden, sondern zu verwandeln
- Führung: Verantwortung wird nicht delegiert, sondern verkörpert
Impuls für Organisationen
„Wenn du Schuld spürst – frag dich, ob du gerade versuchst, Trennung zu erzeugen, wo Verbindung möglich wäre.“
Die Auflösung der Schuldlogik auf E8
- Das Ich ist nicht mehr Zentrum, sondern Durchlass
- Verantwortung wird nicht delegiert, sondern verkörpert
- Schuld wird als Trennungsmechanismus erkannt – sie erzeugt Dualität, wo Resonanz Verbindung sucht
- Kritik wird nicht als Bewertung, sondern als Spiegel für Entwicklung verstanden
Was statt Schuld passiert
- Verantwortung wird als Resonanz getragen
- „Ich spüre, dass ich hier etwas halten darf – nicht weil ich schuld bin, sondern weil ich verbunden bin.“
- Verantwortung entsteht aus Stimmigkeit, nicht aus Pflicht
- Wirkung wird als Bewegung erkannt
- „Was durch mich wirkt, ist nicht mein Besitz – sondern Teil eines größeren Zusammenhangs.“
- Fehler sind Entwicklungsimpulse, keine moralischen Defizite
- Konflikte sind Felder der Klärung
- „Was will sich hier zeigen – und wie kann ich dem Raum geben?“
- Schuldzuweisung würde die Bewegung stoppen – Resonanz hält sie offen
- Kritik ist Einladung zur Tiefe
- „Was du mir spiegelst, ist nicht gegen mich – sondern für das, was durch mich wirken will.“
- Kritik wird nicht abgewehrt, sondern verwandelt
Was diese Haltung bewirkt
- Entpolarisierung: Schuld trennt – Resonanz verbindet
- Entlastung: Das Ich muss nicht perfekt sein, sondern durchlässig
- Entwicklung: Fehler sind nicht zu vermeiden, sondern zu verwandeln
- Führung: Verantwortung wird nicht delegiert, sondern verkörpert
